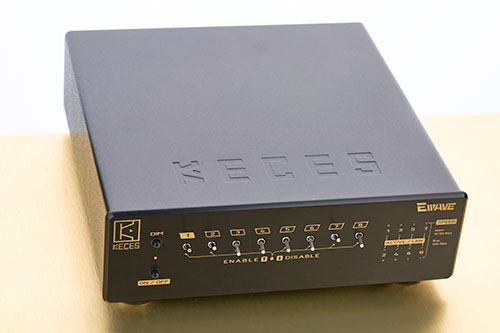Der eigentliche Design- und Bedienungsknüller ist aber der zentrale, vom für Canor typischen orangen Lichtring umgebene Stellknopf auf der Front. Der beeindruckt mit einem integrierten Touchscreen! Mit ihm lassen sich alle Einstellungen ändern und anzeigen. Die Info springt nach einiger Zeit auf die Grundeinstellung zurück. Dies ist alternativ das Canor Logo oder das Logo in Kombination mit zwei abhängig vom Pegel ausschlagenden Zeigern. Alles lässt sich auch in mehreren Stufen dimmen oder ganz schwarz schalten. Die Matrix-Anzeige rechts neben diesem phänomenalen Display-Knopf zeigt den aktiven Eingang und die Lautstärke in Dezibel an. Auf dem Touchscreen können Sie ungenutzte Eingänge löschen. Die sind dann auch per Fernbedienung nicht wählbar. Jeden einzelnen Eingang kann man auch unabhängig voneinander um drei oder sechs Dezibel anheben. Das gilt auch für die integrierte Phonostufe. Bei Bedarf kann man festlegen, über welchen Eingang der A3 in ein Heimkino-System eingebunden werden soll. Der Pegel dieses Eingangs ist dann nicht regelbar. Interessant sind die für PCM oder DSD im Displayknopf wählbaren Filter. Sie lassen sich auch über die System-Fernbedienung ansteuern und so am Hörplatz nach Geschmack aussuchen. Ich habe die angebotenen Filter-Varianten als gut unterscheidbar empfunden und je nach Musikart auch mal gewechselt. Das ist ein schöner Komfort zur Feinjustierung. Wer sich damit nicht beschäftigen will, sucht einmal eines aus und fertig oder belässt es bei der Werkseinstellung. Beim Ein- und Ausschalten des Verstärkers läuft ein Röhrensymbol und ein Countdown, um die Aufwärm- oder Abkühl-Phase anzuzeigen. Das alles macht einen gut durchdachten und praxisgerechten Eindruck. Dieser vielseitige Display-Bedienregler erlaubt durch Drehen, Wischen und Druck noch einige Einstellungen mehr und scheint mir ein ebenso gewöhnungsbedürftiges wie komfortables Bedienelement. Wenn alles perfekt eingestellt ist, sieht man nichts mehr davon und kann sich auf die Musik konzentrieren.

Die Rückseite bietet die für Verstärker üblichen Anschlüsse, erfreulicherweise sowohl in Cinch in als auch symmetrisch XLR. Das gilt auch für den Vorverstärker-Ausgang, an den sich Subwoofer oder eine weitere Endstufe für BI-Amping anschließen lassen. Für den Phono-Eingang trifft man am Touch-Screen-Knopf auf der Front die Auswahl für MM oder MC, für deren Verstärkungsfaktor und für eine der möglichen Kapazitäten und Impedanzen. Diese sind für MM 50, 150, 300 und 400 Picoofarad, für MC 47 und ein Kiloohm sowie 100, 50 und zehn Ohm. Für einen integrierten Verstärker ist diese Option ungewöhnlich vielfältig: Kompliment! Zuerst hat mich bei der musikalischen Beurteilung die digitale Sektion im A3 interessiert. Für die digitalen Eingänge benötigt man einen Zuspieler. Ich nehme da mit Vergnügen den just getesteten Eversolo T8. Der passt ausgezeichnet zur Klasse des Canor Virtus A3, auch preislich, wie ich finde. Neben den digitalen Eingängen S/PDIF-Koax und Toslink, die beide gleich zweimal vorhanden sind, gibt es einen USB-Eingang. Der ist als USB-C ausgeführt, was leider mit den Standard-Verbindungen mit USB-B nur per Adapter zu verbinden wäre. Aber das ist schlichtweg pfui. Erfreulicherweise gibt es exzellente USB-Kabel wie das Audioquest Diamond oder auch günstigere Alternativen mit USB-C Stecker. Allerdings frage ich mich, warum Canor hier nicht auch eine USB-B Buchse eingebaut hat, zumindest alternativ, wenn schon S/PDIF und optisch je zweimal vertreten sind. Sonst gibt es hier nichts Kritisches anzumerken und es ist schnell vergessen, wenn ich mich an´s Musikhören mache. Ich verbinde den Eversolo parallel mit dem günstigen Boaacoustic Evolution Black am koakialen S/PDIF Eingang und mit dem kostspieligen Habst DIII an AES/EBU.

Die Klangunterschiede zwischen den beiden Kabeln hört man zweifelsfrei. Das Boaacoustic klingt wärmer und vergleichsweise etwas schmeichelnd, das zehnmal teurere Habst besser auflösend und cooler. Ganz gleich, welches der beiden spielte, offenbarte sich schnell der Charakter des Virtus A3 und seines integrierten D/A-Wandlers. Das ECM Doppel-Album Jimmy Giuffre 3 1961 (Qobuz-Stream 44,1/16) machte schnell klar, wie toll diese Kombi nuanciert. Beim Bassspiel von Steve Swallow flirren die Saiten, Giuffres Klarinette wird feinst artikuliert und Paul Bleys eigenwilligem, den Rhythmus gebenden, famosen Klavierspiel auf der rechten Seite mag man gespannt lauschen. Das Trio musiziert enorm feinsinnig und mit wunderschönen Klängen. Da fliegen die vier Album-Seiten am Ohr nur so vorbei. Bei solcher Darbietung gerät diese zum Hinhören zwingende Musik zum Genuss und wirkt überhaupt nicht anstrengend. Der Swing ist spürbar und ich bin emotional dabei, besonders schön „Thats True, That´s True“. Ähnlich sauber strukturiert zeigt sich auch das Holly Cole Trio beim Live Album Montreal, das leider nur gut 29 Minuten dauert. Bei „Whatever Lola Wants“ von der per USB-Dockingstation am Eversolo T8 angeschlossenen HDD erlebe ich Holly Coles Gesang eindrucksvoll artikuliert, mit Körper und leicht dunklem Timbre, wie ich es von besten Wiedergabeketten kenne. Gleichzeitig umrahmen die Sängerin Bass, Klavier und das Schlagzeug mit Transparenz und homogen miteinander spielend auf der Bühne. Letztere wirkt klar umrissen, nicht übergroß und verliert sich nicht ins Diffuse – sehr schön. Der Beifall des Publikums führt die Räumlichkeit glaubwürdig vor. Was hier bei diesen vier Akteuren auffällt, ist eine packende Feindynamik, die den Drive in der Musik körperlich spürbar werden lässt. Das Album geht schnell vorbei, „avec plaisir“ wie Holly Cole ihre Zugabe einleitet.